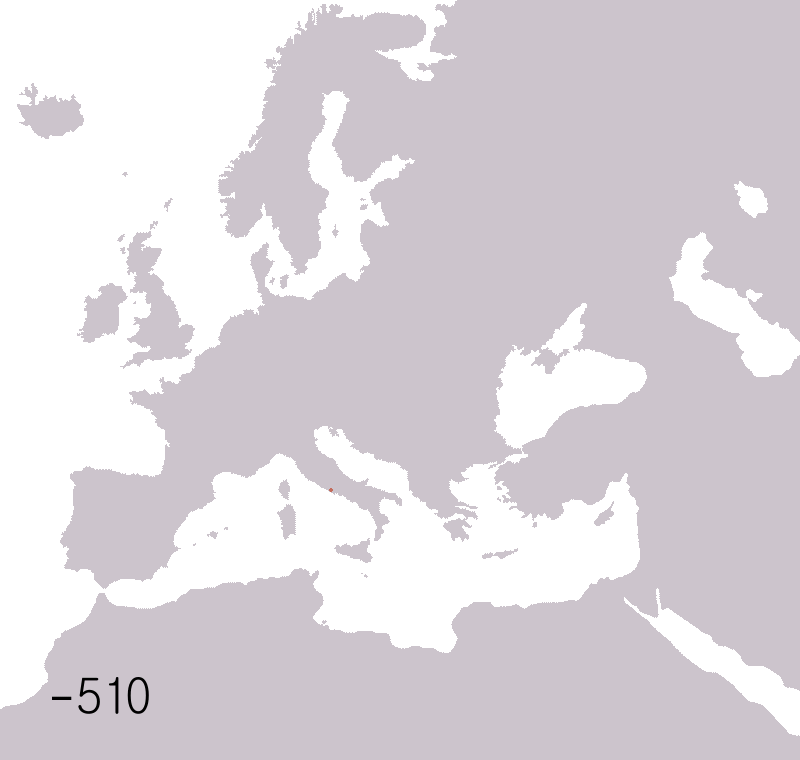
Quelle: commons.wikimedia.org

Bern, Burgerbibliothek, Cod. 85, f. 77r
Biblia Latina (Vulgata), zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts, Bretagne

Bern, Burgerbibliothek, Cod. 85, f. 77v
Biblia Latina (Vulgata), zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts, Bretagne
Latine vertit Ingrides Thiel Iuliacensis.
Quelle: Forum Classicum 2006 (3),240f.
Text als PDF
Begleittext zum Youtubevideo:
Deutsche Radio Philharmonie
Dirigent: Christoph Poppen
Ruth Ziesak, Sopran
Anja Schlosser, Mezzosopran (Alt)
Claudia Mahnke, Mezzosopran
James Taylor, Tenor
Nikolay Borchev, Bariton
Konzertchor Darmstadt (Einstudierung: Wolfgang Seeliger)
Congresshalle Saarbrücken ∙ Freitag, 12. Dezember 20081858, zu seinem zweiten Weihnachtsfest im Amt als Organist der Église de la Madeleine in Paris, stellte Camille Saint-Saëns sein „Oratorio de Noël“ vor, ein lateinisches Weihnachtsoratorium nach Worten der Heiligen Schrift in der Fassung der Vulgata. Liturgisch gesehen, beschränkt sich das Werk streng auf die Verse 8 bis 14 aus dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums, also die Verkündigung an die Hirten. Daran schließen sich umfangreiche Betrachtungen auf biblische Texte aus dem Alten und Neuen Testament an, die Saint-Saëns raffiniert gestaffelt hat: Von solistischen Arien weitet sich die Perspektive kontinuierlich über Duett, Terzett und Quartett bis hin zum Quintett mit Chor und dem folgenden Schlusschor. Mit zehn Nummern und 40 Minuten Spieldauer ist es für die Epoche ein eher knappes Werk, zudem im Stil schlicht gehalten. Dennoch blieb der junge Komponist dem rührenden Sujet an Stimmungsmalerei nichts schuldig.
Unverkennbar handelt es sich um Musik eines Organisten, beschränkte sich Saint-Saëns im Orchester doch auf Streicher, solistische Orgel und die von ihm so geliebte Harfe. Das Orchestervorspiel wird von der Orgel einer Hirtenweise eröffnet. Saint-Saëns dachte sich dieses Präludium „dans le style de Séb. Bach“, im Stile von Bach. Im weich schwingenden Siciliano-Rhythmus spielte er auf die Sinfonia zum zweiten Teil des „Weihnachtsoratoriums“ an und suggerierte damit – wie Bach –das Bild der musizierenden Hirten auf dem Feld bei Bethlehem, bevor der Engel erscheint. Freilich mischten sich dem Franzosen auch andere Farben ins Bild: Anklänge an französische Drehleiermusik und Reminiszenzen an die „Noëls“, jene pastoralen Weihnachtsstücke, die französische Organisten in der Christmette zu improvisieren pflegen.
Es folgen die Verse 2, 8-14 aus dem Lukasevangelium, vorgetragen von den vier Solisten im Wechsel. Das Rezitativ wirkt bei Saint-Saëns archaischer als bei Bach, angelehnt an den Rezitationston der katholischen Liturgie und von der Orgel in lange ausgehaltenen Akkorden begleitet. Lediglich bei den Verkündigungsworten geht der Sopran in ein hochromantisches Arioso über, das seine höchste Emphase bei den Worten „Christus Dominus“ erreicht. Erst beim „Gloria in excelsis Deo“ setzen auch die Streicher ein. Dabei ließ Saint-Saëns seine Engel über Bethlehem nicht in barockem Überschwang jubilieren, wie es Bach und Händel taten, sondern im strengen Kirchenstil Palestrinas.
Den Reigen der Arien eröffnet der Sopran in sanft schimmerndem E-dur und im Ton demütiger Heilserwartung („expectans expectavi Dominum“). Inbrünstiger und schon weit über Weihnachten hinaus weisend besingt der Tenor das Warten der Gläubigen auf den Erlöser („Domine, ego credidi“). Der Chor stimmt demütig in seinen Gesang ein. Erst die Harfentöne des folgenden Duetts verwandeln das Kommen des Messias in eine pastorale Genremusik: „Benedictus qui venit in nomine Domini“. Über quasi hingetupften Akkorden der Harfe und der Orgel stimmen Sopran und Bass eine Art weihnachtlicher Barcarole an. Bei der Stelle „Deus meus“ gehen sie in innigen Choralgesang über. Der Kontrast zum folgenden Chorsatz könnte kaum größer sein: Das „Warum toben die Heiden?“ vertonte Saint-Saëns ganz im Stile Händels: als wuchtigen Aufruhr der Chorstimmen über einem kräftigen Unisono-Thema der Streicher. Umso rührender der fast süßliche Schluss dieses Satzes.
Hochromantisches Arpeggio der Harfe begleitet das Terzett „Tecum principium“, während das „Alleluja“-Quartett wie ein Weihnachtschoral im Dreiertakt daher kommt. Seinen Höhepunkt erreicht das Oratorium in dem Quintett mit Chor „Consurge, Filia Sion“. Hier hat Saint-Saëns die Musik des Prélude wieder aufgegriffen. In die pseudo-Bachischen Harmonien der Hirtenmusik tönen nun die Solisten hinein. Ihr Wechselgesang zwischen Frauen- und Männerstimmen gleicht einem Weihnachtshymnus, in den der Chor immer wieder mit seinem „Alleluja“ einstimmt. Der Choralsatz eines schlichten Weihnachtsliedes beschließt das Werk.

Der Thesaurus Linguae Latinae (TLL) lädt dazu ein, über das lateinische Wort des Jahres 2025 abzustimmen. Die «Vox Anni»-Wahl geht damit bereits in die vierte Runde – nach früheren Gewinnern wie rescellula, resocio und zuletzt retotatototato.
Bis zum 14. Dezember 2025 (24:00 CET) kann abgestimmt werden; am 17. Dezember wird das Siegerwort bekannt gegeben.
Zur Wahl stehen sechs ungewöhnliche, witzige und sprachhistorisch faszinierende Begriffe – alle neu im TLL-Faszikel R12 (von reus bis robustus) belegt. Die vollständige Vorstellung findet sich im Parerga-Blog, die der hier folgenden Beschreibung zugrunde liegt.


Ein selten belegter, ursprünglich griechischer Fachbegriff für Stabweissagung, der vor allem bei Hieronymus und Julian von Eclanum auftaucht. Beide Autoren kennzeichnen das Wort ausdrücklich als fremd. Trotzdem nimmt der TLL es auf – als hilfreichen Orientierungspunkt für alle, die sich durch spätantike Texte lesen.

Das vielleicht rätselhafteste Wort der Liste. Es findet sich nicht einmal sicher im lateinischen Textbestand: Die moderne Forschung vermutet rhoezos bzw. rhoezo als Korrektur einer verderbten Stelle im Catalepton 5.2 (zugeschrieben Pseudo-Vergil). Das Wort bezeichnet im Griechischen das schwirrende, zischende Geräusch von Bewegung – etwa von Pfeilen oder Flügeln – und wird im lateinischen Kontext als Bild für rhetorisches «Geschwätz» gelesen.

Gebildet aus rhonchus («Schnarchen») + -issare (Verbalisierung) + -tor (Agensendung). Wo Plinius noch von stertentium sonitus («Geräusch von Schnarchenden») spricht, setzt ein spätantiker Glossator auf maximale Anschaulichkeit: rhonchissator – der Schnarcher.

Wie knurrt ein Hund auf Latein? Rir lautet die Antwort. Zugleich erklärt sie, warum die Römer den Buchstaben R die littera canina («Hunde-Buchstabe») nannten. Der Ausdruck begegnet in der antiken Etymologie des seltenen Verbs ringor («knurren, die Zähne fletschen»).

Das bekannteste Wort für «Reis» ist oryza. Doch die Variante risum / risi zeigt bereits den Weg zu modernen Formen wie italienisch riso oder französisch riz.
Der sprachhistorische Weg:
Belegt ist das Wort in einer spätantiken lateinischen Übersetzung eines griechischen medizinischen Textes – dort wird der therapeutische Einsatz von Reisbrei diskutiert.

Zum italienischen roba sowie das französische robe (und damit auch das englische robe) muss ein Vorläufer im gesprochenen Latein existiert haben, der Nachweis dafür ist nur indirekt und eher vage. Die besten Belege finden sich bisher nicht in einem lateinischen Text, sondern in einer einmaligen Entlehnung ins Altgriechische. Die griechische Inschrift, die dieses Lehnwort enthält, nennt die Identität eines Mannes, der in der Küstenstadt Korykos bestattet wurde. Sie lautet: «(Dies ist der) Sarkophag des Marinos, Näher von Kleidern (robōn)». Die etymologische Erklärung führt aus, dass roba aus einem germanischen Wort entlehnt wurde (vgl. engl. rob, deutsch geraubtes Gut, besonders geraubte Kleidung).
Der TLL lädt alle Latinisten, Lehrkräfte, Studierenden und allgemein Sprachbegeisterten ein, ihr Lieblingswort zu küren.
Die Abstimmung erfolgt online – offen bis zum 14. Dezember 2025. Den Link zur Abstimmung findet man im Originalartikel.